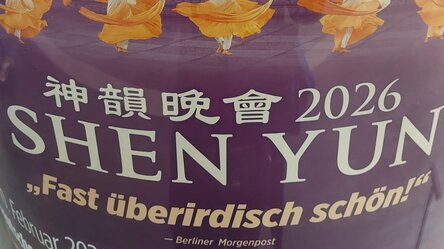Das neue aktualisierte Stichwort zu Falun Gong/Falun Dafa „Entwicklungen“ nimmt in Anknüpfung an das einführende Stichwort neuere Entwicklungen und Aktivitäten in der im Kampf gegen die KP Chinas stehenden Bewegung in den Blick (Epoch Times, Verschwörungstheorien und Apokalyptik, Kulturtheater „Shen Yun“).
Falun Gong / Falun Dafa (Entwicklungen)

Transformationen im religiösen Feld Chinas1
Zur Genese einer Kultivierungspraxis
Es war in den 1970ern und 1980ern, im spirituellen Vakuum der Zeit nach dem Maoismus, als Millionen von hauptsächlich älteren und städtischen Bürgern in China damit begannen, Qigong genannte Leibesübungen zu praktizieren. Sie knüpften dabei an Techniken an, die kommunistische Kader bereits in den 1950er Jahren zur Gesundheitsförderung aufgriffen, nachdem sie über Jahrhunderte hinweg buddhistischen Mönchen, daoistischen Kampfkünstlern und konfuzianischen Gelehrten dazu gedient hatten, Körper und Geist zu schulen bzw. zu „kultivieren“, wie im Qigong-Kontext gerne gesagt wird. Im Zuge dieser Qigong-Welle, die ab den 1980ern aufgrund des Gesundheitsaspektes auch von der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) gefördert wurde, entstanden unzählige Schulen. Dort unterrichteten charismatische Meister die als „Ener‐ gie-Arbeit“ (qi-gong, gespr. gung) verstandenen gesundheitsfördernden Leibes- und Energieübungen und entwickelten zudem eigene weltanschauliche Systeme. Zur Überwachung und Kontrolle dieser Schulen und ihrer modernen Meister gründete die KPC 1985 die staatliche Qigong-Forschungsgesellschaft Chinas.
Einer dieser Meister war Li Hongzhi (geb. 1951). Von ihm stammt die 1992 vorgestellte Qigong-Bewegungspraxis „Falun Gong“ (auch „Falun Dafa“, wörtlich „Dharma-Rad-Praktik“), in der er buddhistische, daoistische und konfuziani‐ sche Vorstellungen zu einer ganz eigenständigen Weltanschauung verband. Grundlegende Topoi der Qigong-Philosophie wie pulsierende Energieströme, „Meridiane“ als deren Bahnen und die als Energieknotenpunkte vorgestellten „Chakren“ werden mit einer ganz spezifischen Vorstellung vom Kosmos ver‐ knüpft: Dieser bestehe aus den drei substanzhaft bzw. feinstofflich gedachten Prinzipien Wahrhaftigkeit (zhēn), Barmherzigkeit (shàn) und Nachsicht (rěn) und müsse im menschlichen Tun abgebildet werden. Die von Hongzhi entwi‐ ckelte „Kultivierungspraxis“2 besteht darin, sich über fünf spezifische Körperübungen, die gute und schlechte Energieströme aufnehmen bzw. ableiten, diesen drei kosmischen Prinzipien und damit der Natur des Kosmos anzugleichen (vgl. Eißler 2011). Die Angleichung wird im Vollzug der Übungen durch das Abtragen von Karma (ye) und die Kultivierung von Tugend (dé ) erzielt und ist gleichbedeutend mit einer Rückkehr zum „ursprünglichen, wahren Selbst“. Schlussendliches Ziel ist das Einswerden mit der Natur des Kosmos bzw. die „Unsterblichkeit“.3 In Zhuan Falun („Das Rad des Dharma drehen“), seinem 1995 veröffentlichten Hauptwerk, schreibt Hongzhi: „Doch ganz gleich wie sich die moralischen Normen der Menschheit auch verändern, die Eigenschaften dieses Kosmos bleiben unverändert. Sie sind der einzige Maßstab, um zu beurteilen, wer ein guter und wer ein schlechter Mensch ist“ (2015, 19).
Hauptsymbol dieser durchaus elitären Kultivierungspraxis ist das „Rad des Gesetzes“ ( falun) als Abbild des gesamten Kosmos (dargestellt in einer großen Swastika). Als ein „sich drehendes intelligentes Wesen von hoher energetischer Substanz“ (Eißler 2011, 31) sammelt das „Gesetzesrad“, von Hongzhi selbst im Unterbauch des Kultivierenden eingesetzt, in pausenloser Drehbewegung Energie aus dem Kosmos, wobei die Übungen helfen sollen, über verschiede‐ ne Bewegungsabläufe schlechte Energie abzubauen und gute Energiesubstanz aufzunehmen. Mit dieser Verbindung der buddhistischen Vorstellung von (Selbst-)Kultivierung mit animistischen und kosmologischen Vorstellungen des Daoismus etablierte Hongzhi einen ganz eigenständigen methodisierten Heilsweg, der den Falun-Gong-Praktizierenden selbst eine zentrale Rolle bei der Rettung der Menschheit zuweist. Denn anders als die Religionen und diversen Qigong-Praktiken, die von Falun Gong auf einer niederen Stufe verortet werden, weil sie eine direkte Verbindung mit den kosmischen Prinzipien vollständig oder teilweise vermissen lassen, setzt die in kosmischen Dimensionen gedachte Kultivierung von Falun Gong direkt auf der höchsten Ebene an. Sie ist in der Zeit des kosmischen Übergangs und der Erneuerung des Kosmos in der Lage, das „Gesetzesrad“ neu „auszurichten“ bzw. zu „korrigieren“ (zhengfa).
Anerkennung, Entfremdung und Konfrontation
Die 1992 von Hongzhi ins Leben gerufene Qigong-Praxis erlangte aus dem Stand, nicht zuletzt aufgrund der guten Beziehung zu den chinesischen Behörden, eine so große Popularität, dass sie bereits im August 1993 durch die staatliche Qi‐ gong-Forschungsgesellschaft offiziell approbiert wurde. Die extensive Nutzung des damals noch jungen Internets und digitaler Kommunikationskanäle (vgl. Tong 2016, 66f.) ermöglichte Falun Gong nicht nur die schnelle Verbreitung von Hongzhis Lehren, sondern auch einen kontinuierlichen Kontakt zwischen den Praktizierenden. Für die chinesische Qigong-Forschungsgesellschaft bewegte sich Falun Gong, trotz der über die übliche Praxis hinausgehenden weltanschaulichen Elemente, zunächst noch in einer tolerierten Grauzone. Die Situation änderte sich mit dem Erfolg der Bewegung und dem wachsenden religiösen Selbstbewusstsein Hongzhis – unter anderem mit der „Stilisierung als lebender Buddha“ (Meyer 2013, 157). Nach Darstellung der KPC wurde Hongzhi 1995 aufgrund „groß angelegter Selbstspiritualisierung und Propagierung von feudalem Aberglauben“ (Penny 2012, 50) aus der Qigong-Vereinigung ausgeschlossen. Nach Darstellung von Falun Gong hingegen habe sich Hongzhi geweigert, innerhalb seiner Schule eine Zweigstelle der KPC zu gründen, und sei dann aus eigenem Antrieb ausgetreten. Sicher ist nur eines: Trotz teils heftigster Kritik der Regierung an Falun Gong hat die Bewegung zunächst durch geschickt lancierte Appelle an die Öffentlichkeit und mit Hilfe der Unterstützung von Teilen der KPC noch Zugeständnisse erwirken können (vgl. Tong 2016). Zugleich war es nur eine Frage der Zeit, bis die gegenseitigen und teils erbitterten Feindseligkeiten eskalieren würden. Am 25. April 1999 war es dann so weit: Vielleicht Zehn‐ tausende Falun-Gong-Anhänger (die Zahlenangaben schwanken) umzingelten aus Protest gegen die Maßnahmen der KPC deren Parteizentrale. Während Falun Gong die Großdemonstration als spontane Aktion einzelner Praktizierender darstellte, machte die KPC – ob berechtigt oder nicht, ist nach wie vor umstritten (vgl. Tong 2016, 67f.) – Hongzhi als Drahtzieher dieser massiven regierungsfeindlichen Mobilisierung aus. Drei Monate später wurde Falun Gong als illegale Organisation eingestuft und chinaweit verboten. Damit fand die Beziehung der KPC zu religiösen Akteuren, die bisher durch gegenseitige Verbindlichkeiten charakterisiert war, ein abruptes Ende. Bis 1999 hatte die Religionspolitik der KPC in einem eingeschränkten Rahmen einen religiösen Markt zugelassen, diesem jedoch klare Grenzen gesetzt, die durch die „Priorität des Staates vor dem Einzelnen und den religiösen Anliegen“ (Meyer 2013, 160) definiert waren. In Entsprechung zur spezifisch konfuzianischen Pietät gegenüber der eigenen Familie erwartete die Partei, wie früher der Kaiser, absolute Loyalität gegenüber dem Staat.4 Mit der Mobilisierung Zehntausender Falun-Gong-Anhänger gegen die Staatsmacht waren die Grenzen dieses dynamischen Aushandlungsprozesses überschritten und mit dem Verbot von Falun Gong – mit dem Hongzhi selbst wohl nicht gerechnet haben dürfte – ein beide Seiten radikalisierender Machtkampf eröffnet. Die KPC stufte die zunächst als „Aberglaube“ diffamierte Bewegung bald als „heterodoxe Lehre“ sowie als „bösen Kult“ ein, um den auf die Vernichtung Falun Gongs zielenden (und bis heute aufrechterhaltenen) Verfolgungsapparat zu rechtfertigen. Mit dieser Etikettierung bezog sich der damalige Staatspräsident Jiang Zemin ganz bewusst auf die westlichen Debatten über sektiererische Kulte und die Anti-Kult-Bewegung (vgl. Ownby 2008, 21f.).
Informationskrieg: Das Internet und die Epoch Times
Kommunikationsräume zur weltanschaulichen Vernetzung
Um seine Aktivitäten aufrechtzuerhalten, ging Falun Gong in den Untergrund, verlegte den Schwerpunkt der Arbeit ins Ausland und fokussierte sich nun verstärkt auf das Internet und den Aufbau von unzähligen Websites.5 In Reaktion auf die Einordnung als „böser Kult“ durch die KPC begann Falun Gong nun selbst, die Partei und den als hauptverantwortlich angesehenen Jiang Zemin zu dämonisieren. Sich selbst beschreibt Falun Gong als „spirituelle Kultivierungspraxis“ sowie, in Abgrenzung zu den fünf in China anerkannten Religionen und in Entsprechung zur marxistischen Terminologie, als „Metawissenschaft“ (Meyer 2013, 157).6 Hongzhi selbst war bereits 1996 in die USA emigriert und begann dort, knapp hundert Kilometer nordwestlich von New York in Dragon Springs bei Cuddebackville, die Zentrale seiner Bewegung aufzubauen sowie ein umfangreiches Mediennetzwerk mit zahlreichen Websites zu errichten. Die ab Mitte der 2000er Jahre verfügbaren Plattformen Facebook und YouTube erwiesen sich als nützliche Hilfsmittel, um Falun Gongs Medienpräsenz zu verstärken. Zur selben Zeit konnte sich die Fernsehanstalt New Tang Dynasty Television, die in den Umkreis von Falun Gong gehört, nach eigener Aussage als „größter unabhängig geführter chinesischer Fernsehsender der Welt“7 etablieren. Auch wenn Falun Gong die Verbindung mit dieser Einrichtung nicht offen kommuniziert, wohl um sie vor Repressalien zu schützen und das neutrale und internationale Image nicht zu schädigen, bildet sie zusammen mit den vielfältigen eigenen Me‐ dien- und Internetunternehmen den zentralen Raum zur Vernetzung zwischen Organisatoren und Praktizierenden. Das Internet wiederum dient Falun Gong – als einer gleichsam „virtuellen Organisation“ (Tong 2016, 72) – insbesondere dazu, die Anhänger regelmäßig mit den Lehren und Botschaften Hongzhis zu versorgen. Welche Websites nun „offiziell“ mit Falun Gong in Verbindung stehen8 und welche mit der Bewegung lediglich sympathisieren und offiziellere Texte wiederveröffentlichen, ist dabei oft nur schwer zu unterscheiden.
Die Epoch Times als verschwörungsaffines Nachrichtenmagazin
Auch bei der kostenlosen Zeitung Epoch Times, die online und gedruckt vertrieben wird, dürfte nicht allen Lesern die Nähe zu Falun Gong bewusst sein. Im Jahr 1999 unmittelbar nach dem Verbot von Falun Gong gegründet und herausgegeben von Mitgliedern der Bewegung, hat sich das in über 35 Ländern (auch in Deutschland) erscheinende Blatt zu einer der „größten ethnischen Zeitungen der Welt“ (Tong 2016, 68) entwickelt. Sie ist ein zentrales Sprachrohr der Bewegung und sorgt mit verschwörungstheoretischen Artikeln und politischer Einflussnahme (insbesondere bei den zurückliegenden US-Wahlen) regelmäßig für Irritationen. Die Strategie der Zeitung scheint darin zu bestehen, über sogenanntes „Narrative Switching“ zunächst ganz banale oder unpolitische Dinge zu behandeln, dann zu hochpolitischen Themen zu wechseln und dort gezielt politische Botschaften zu verbreiten (Peng, Yang und Fang 2025, 2102). War die Epoch Times in den ersten Jahren ihres Bestehens eine primär gegen die KPC gerichtete Nischenpublikation, hat sie sich in den letzten beiden Jahrzehnten zu einem einflussreichen Akteur in der rechtspopulistischen US-Politik entwickelt, der mit seinen Botschaften die politische Aufmerksamkeit wirksam zu lenken versteht. Zur Erweiterung der Leserschaft hat die Epoch Times in den letzten Jahren zunehmend in Facebook-Werbung investiert. Bereits Ende 2021 hatte sie über neun Millionen Follower akquiriert und damit im Bereich rechtspopulistischer Medien die Konkurrenz namens Breitbart und Newsmax übertreffen können (Peng, Yang und Fang 2025, 2089f.). In der chinakritischen Stoßrichtung dürfte ein wichtiger Grund dafür liegen, dass die Epoch Times mittlerweile auch in Kreisen der US-Regierung (insbesondere bei Donald Trump) auf Resonanz stößt. Die Zeitung positioniert sich dabei selbst als eine alternative Stimme, die sowohl gegen westliche Mainstream-Medien als auch gegen den repressiven chinesischen Staat kämpft und der „Aufklärung der Wahrheit“ dient (Peng, Yang und Fang 2025, 2091f.). Dazu gehört die Aufklärung darüber, dass verschiedenen Ethnien jeweils entsprechende Himmelsräume zugewiesen sind und Individuen gemischter Herkunft einen Teil ihrer Verbindung zu ihrem jeweiligen Himmelsraum verlieren,9 ferner die Aufklärung darüber, dass die Geheimdienste Informationen über Ufo-Bewegungen und außerirdisches Leben im All zurückhalten (vgl. Malone 2023; Werner 2025). Wesentlich ist auch, in regelmäßigen Abständen – auch in der deutschen Ausgabe – über die spirituelle Disziplin Falun Gong und die Geschichte ihrer Verfolgung und Unterdrückung in China (und anderswo) zu berichten (z.B. Fu 2025).
Radikalisierung und die chinesische Apokalypse
Apokalyptische Traditionen und die zu Ende gehende Weltzeit
Nach dem Verbot von Falun Gong im Jahr 1999 gewann das Thema Endzeit in der Bewegung eine stetig wachsende Bedeutung. Eine Reihe von Falun-Gong-Autoren bemühte sich nun, das von Hongzhi vertretene apokalyptische Konzept vom letzten Dharma-Zeitalter, von einer (End-)Zeit des kosmischen Übergangs und der „Neuausrichtung“ des Kosmos, in einer universalen, über den Buddhismus hinausgehenden Perspektive zu erweitern. In unzähligen um die Jahrtausend‐ wende publizierten Artikeln, Flugblättern oder Briefen klärte die Bewegung in „schockierenden Prophezeiungen“ (Tong 2016, 65f.) über den bevorstehenden Zusammenbruch des kommunistischen Regimes in China auf und griff dabei unter anderem auf zwei Prophezeiungsbücher aus dem alten China (bzw. aus der Tang- und Ming-Dynastie) sowie überraschenderweise auf die Johannesapokalypse zurück. Eine solche Referenz scheint für eine spirituelle Bewegung, die eng mit Qigong und dem buddhistischen Glauben verbunden ist, auf den ersten Blick befremdlich. Doch die Überzeugung, in einer Abfolge endzeitlicher Ereignisse als Hauptakteur zu fungieren, hat nicht wenige Falun-Gong-Anhänger dazu veranlasst, sich dem Genre der apokalyptischen Literatur ganz unabhängig von kulturellen und religiösen Hintergründen zuzuwenden, in der Hoffnung, dort inhaltliche Unterstützung für ihre Vision von der Zukunft Chinas zu finden. Neben dem Mayakalender und Nostradamus gewann dabei insbesondere auch die Offenbarung des Johannes eine stetig wachsende Prominenz. Das Interesse an der Johannesapokalypse liege einem Falun-Gong-Autor zufolge darin begründet, dass sie in einer tiefgreifenden Symbolik „sowohl von einer Verwüstung als Gericht Gottes über die Welt als auch von einer letzten Hoffnung der Menschheit“10 spricht. Gelesen als Spiegelung des eigenen Kampfes gegen das kommunistische China dienen diese Prophezeiungen nicht zuletzt dazu, das Ansehen von Falun Gong bei einem westlichen Publikum zu stärken, das mit den religiösen Traditionen Chinas weniger vertraut ist.
Hongzhi selbst war in seiner anfangs ausschließlich auf China ausgerichteten Mission von Anbeginn davon überzeugt, in den letzten Tagen eines kosmischen Zyklus zu leben (vgl. Chang 2004). Seine Rede von einer „Endzeit“ oder „Apokalypse“ hat dabei nichts mit den Topoi christlicher Eschatologie zu tun – wenngleich es der Bezug auf die Johannesapokalypse nahelegen könnte. Hongzhi rekurriert auf buddhistische Vorstellungen von Dharma- bzw. Gesetzeszyklen und gibt damit der stark vom Daoismus beeinflussten Praxis der Kultivierung von Energie eine apokalyptische Prägung (vgl. Palmer 2007). Sein bereits ge‐ nanntes Hauptwerk Zhuan Falun vom „Drehen“ (zhuan) des „(Dharma-)Rades“ ( falun) lässt keinen Zweifel: Hongzhi sieht sich dazu gesandt, das Falun Dafa zu verbreiten, um „in dieser letzten Periode [des zu Ende gehenden Dharma- Zeitalters] Rettung zu bringen“ (Chang 2004, 91) und die Welt vom Bösen zu befreien. Damit ist zugleich die Qigong-Vision vom perfekten Menschen durch ein apokalyptisches Szenario ersetzt: Weil die existierenden religiösen und welt‐ anschaulichen Traditionen in der gegenwärtigen Periode des zu Ende gehenden Dharma teils „dämonisch besessen“ und die modernen Wissenschaften zudem „von außerirdischen Wesen gesteuert“ seien, sollen die Praktizierenden beides strengstens vermeiden und sich angesichts des bevorstehenden Endes der Welt (bzw. des Dharma-Zyklus) ausschließlich dem „höheren Dharma von Falun Gong“ widmen (Palmer 2007, 224).
Neuinterpretationen: Der „rote Drache“, das „Tier“ und der „König der Könige“
Die „Apokalypse“ wird dabei nicht etwa als militärischer Konflikt, sondern als Triumph des „Guten“ über das „Böse“ bzw. als endzeitlicher Konflikt zwischen einer „spirituellen Praxis“ (Falun Gong) und einer „Ideologie“ (chinesischer Kommunismus) verstanden. Vor allem unmittelbar nach dem Verbot 1999 dien‐ ten Interpretationen fremdreligiöser Prophezeiungen und Apokalypsen primär dem Zweck, die Dämonisierung der KPC zu legitimieren und zugleich dem gegen sie gerichteten Kampf Dringlichkeit zu verleihen. So wurde der „treu und wahrhaftig“ genannte apokalyptische Reiter aus der Johannesoffenbarung, der „richtet und in Gerechtigkeit Krieg führt“ (Apk 19,11–16), mit Hongzhi identifiziert, der für die Unterdrückung und Verfolgung von Falun Gong verant‐ wortliche Staatspräsident Jiang Zemin hingegen mit den in Apk 16,13 erwähnten „unreinen Geistern, wie Frösche“ (vgl. Tong 2016, 75f.) in Verbindung gebracht. Und auch die Frage, was mit dem „roten Drachen“ (Apk 12), dem „Tier“ (Apk 13), den „zweiundvierzig Monaten“ (Apk 13,5) und den „vollendeten tausend Jahren“ (Apk 20,7) gemeint sei, erfuhr in den Auslegungen der Falun-Gong-Akteure eine schlüssige Klärung: Es geht in all diesen Wendungen um das kommunistische China, Jiang Zemin (das „Tier aus dem Meer“), das Jahr 1999 (Vollendung der „tausend Jahre“) und den Krieg der KPC gegen Falun Gong, der nun allerdings nicht das in der Johannesapokalypse prophezeite Ende fand (das wäre 2003, also zweiundvierzig Monate nach dem Jahr 1999 gewesen), sondern bis heute anhält. Die ausgereifte weltanschauliche Lehre sowie die organisatorischen Strukturen, die Zentralität (die Zentrale von Falun Gong in den USA) und Dezentralität (zahlreiche transnationale Websites und Institutionen) verbinden, dürften dabei geholfen haben, die Fehlinterpretation des für 2003 vorausgesagten Endes der KPC relativ unbeschadet zu überstehen.11 Ohne große Rationalisierungsversuche wurden nach dem Januar 2003 einfach neue interpretative Einsichten in die Johannesoffenbarung angeboten, auch durch das Falun-Gong-Magazin Minghui, das durch wiederholte Beiträge nach Kräften die Ansicht unterstützte, die in der biblischen Offenbarung prophezeiten „großen Ereignisse“ seien „bereits im Gange“.12 Insbesondere die beiden Symbole des „roten Drachen“ und der Zahl 66613 würden beweisen, dass sich die biblischen Passagen auf die aktuelle Situation in China beziehen und bislang verkürzt oder gar falsch interpretiert wurden (vgl. Tong 2016, 77ff.). Diese Neudeutungen der Johannesapokalypse schufen nicht nur ein Gefühl von globaler Bedeutung, sondern brachten Falun Gong zugleich mit einer universelleren und inklusiveren Lesart von Transzendenz („der eine Gott“, „das göttliche Prinzip“) in Verbindung.
Zugleich stärkten diese Interpretationen die grundlegende Überzeugung, dass das, was die Johannesapokalypse offenbart, weit über das Judentum und das Christentum, aber auch über den Daoismus und den Buddhismus hinausgeht: „Was Johannes sagt, geht weit über das Wissen der Menschen im Westen und im Osten hinaus […]. Die wahre Frage der Offenbarung des Johannes lautet: Wer ist der Messias?“14 Die Antwort auf diese Frage überführte die christliche Erlösungsbotschaft in ein Panorama des Heils, in dem Falun Gong die alle ethnischen und religiösen Gruppen vereinende Religion ist und Hongzhi als „Erlöser der Menschheit“15 gilt: […] der Heilige König von Falun, der Ehrliche und Wahrhaftige, der König der Könige, der Herr der Herren, der Heilige Logos. Meister Li Hongzhi ist der Messias, also muss alles Lebendige vom Messias-Meister Li Hongzhi gerettet werden, um eine Zukunft zu haben! Dies ist das Geheimnis der Offenbarung des Johannes.16 Seit der Millenniumswende haben die in der westlichen Hemisphäre verbreiteten apokalyptischen Narrative also innerhalb von Falun Gong eine erhebliche Transformation erfahren: Die Prophezeiungen vom Untergang der KPC, die sich nicht bewahrheitet haben, sind universaleren und zugleich subversiveren Beschreibungen einer durch „spirituelle“ Bande und religiöse Symbole vernetz‐ ten Welt gewichen, die nun von Hongzhi als „Herrn der Herren“ und „König der Könige“ dem Heil entgegengeführt wird.
Imagepflege durch Kulturtheater: „Shen Yun“ und der kosmische Rhythmus
Kultivierung (nicht nur) des Selbst und repressive Disziplin
Seit fast zwei Jahrzehnten tourt „Shen Yun Performing Arts“, ein 2006 in der Falun-Gong-Zentrale in den USA gegründetes Ensemble für darstellende Kunst und Unterhaltung, durch die Welt und füllt mit seiner Show „Shen Yun“, die chinesischen Volkstanz, Instrumentalmusik und Operngesang vereint, die Säle großer renommierter Theater. Das mit unzähligen Mitwirkenden opulent auftretende Tanztheater möchte mit seinen Darbietungen ein „China vor dem Kommunismus“ lebendig werden lassen und präsentiert sich als buntes und ästhetisch durchaus beeindruckendes Folklore-Event mit Volkstänzen nationaler Minderheiten Chinas.
Doch die Show, die in einigen der Tanzstücke auch das zeitgenössische China thematisiert, darunter die seit 1999 anhaltende Verfolgung von Falun Gong, ist noch sehr viel mehr als Tanztheater, wie eine im Februar 2025 ausgestrahlte Folge des ZDF Magazin Royale nicht zu Unrecht festgestellt hat: Die Veranstaltung dient Falun Gong zum einen dazu, auf das Schicksal der Bewegung und das Ergehen ihrer Anhänger in China aufmerksam zu machen, zum anderen aber auch dazu, die Finanzierung der Epoch Times und des Fernsehsenders New Tang Dynasty Television und damit den Informationskrieg gegen die chinesische Regierung zu sichern. Doch sorgen die in der Fei Tian Academy of the Arts in Dragon Springs ausgebildeten Tourneegruppen mit mehr als fünfhundert Tänzerinnen und Tänzern nach Recherchen der New York Times (NYT) nicht nur für beträchtliche Einnahmen.17 Sie unterliegen zugleich einem äußerst strengen, ja geradezu „ausbeuterischen“ Regime.18 Im Jahr 2024 reichte ein ehemaliges Mitglied auch im Namen weiterer mutmaßlich Geschädigter eine Klage ein und warf „Shen Yun“ unter anderem vor, „jugendliche Tänzer erniedrigenden Disziplinierungsmaßnahmen ausgesetzt und ihnen im Falle einer Kündigung mit Gewalt gedroht zu haben“.19 Auch Jan Böhmermann griff in der erwähnten Folge des ZDF Magazin Royale NYT-Recherchen auf, die ergaben, dass „die Darsteller:innen von Shen Yun – von denen viele minderjährig waren – […] zermürbende Arbeitsstunden bei geringer Bezahlung [leisteten].“20 Damit brachte er das vielfach gepflegte Bild ins Wanken, dass Falun Gong eine von repressiven Normen und Methoden völlig freie und allein spirituellen und gesundheitlichen Zielen verpflichtete volksreligiöse Bewegung sei.
Der in Deutschland ins Vereinsregister eingetragene und im hessischen Gorxhei‐ mertal ansässige Verein Falun Dafa e.V. hat, um den Imageschaden abzuwehren, zu den Vorwürfen alsbald Stellung bezogen.21 Böhmermanns Bezeichnung von Falun Gong als „Psychosekte“ mit angeblich „rechtsextremen Tendenzen“ habe demnach nicht nur das öffentliche Bild der Bewegung diskreditiert, sondern auch die Verfolgung durch die KPC relativiert. Schon allein der Begriff „Sekte“ diene dem chinesischen Regime „als verbaler Schlagstock“ zur Legitimierung der widerrechtlichen Verfolgung. Erst recht rufe aber der Begriff „Psychosekte“ „die Assoziation mit psychischen Störungen und destruktiven Gruppen“ hervor und sei daher „irreführend und diskriminierend“. In der Tat hatte das von Böhmermann als Rechtfertigung für diese Bezeichnung genannte Urteil des Landgerichts Leipzig vom 20. Januar 2005 den Begriff „Psychosekte“ nicht verwendet. Doch schrieb es Falun Gong und damit indirekt auch Falun Dafa e.V. „den Charakter einer neureligiösen Sekte mit hierarchischen Anhängerstrukturen“ sowie ein „elitäres und sektiererisches Gruppenbewusstsein“ zu. Der Verein selbst legte gegen dieses Urteil Berufung ein, zog diese Berufung jedoch mangels Erfolgsaussichten wieder zurück und akzeptierte schließlich eine dem Leipziger Urteil entsprechende Rechtsauffassung des Oberlandesgerichts Dresden (Az. 14 U 265/05): „Wenn wir schon eine Sekte sein sollen, dann mit Sicherheit eine harmlose und gute.“22
Ordnung („Rhythmus“) des Kosmos und (Heils-)Exklusivismus
Ist Falun Gong damit nichts weiter als eine „tiefgründige Kultivierungspraxis, die ihre Wurzeln fest in der jahrtausendealten traditionellen chinesischen Kultur verankert hat“, wie es Falun Dafa e.V. in seiner Stellungnahme abschließend beschreibt?23 Hongzhis synkretistische Bewegungspraxis kommt dem modernen Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit sowie dem energetischen Denken moderner Spiritualität entgegen und ist weder jahrtausendealt noch ohne Spannungen mit den in China etablierten Meditations- und Kultivierungspraktiken zusammenzu‐ denken: Der ebenso umfassende wie exklusive Anspruch, den Hongzhi in seinem Hauptwerk Zhuan Falun artikuliert, dass mit der pausenlosen „Drehung“ des substanzhaft gedachten „Dharma-Rades“ im und mit dem eigenen (Unter-)Leib in der Falun-Gong-Praxis die allein heilbringende, weil spirituelle Perfektion ermöglichende Methode offenbart sei, ist in dieser Ausschließlichkeit, verglichen mit anderen Qigong-Bewegungen und -Praktiken, eher ungewöhnlich und höchst elitär. Gleiches gilt für Hongzhis apokalyptische Kosmologie und Dämonologie sowie für die Überzeugung, er sei der endzeitliche Erlöser, Buddha Maitreya und/oder Messias, die er selbst nie dementiert oder kritisiert hat.
Die Namensbestandteile der Tanzshow „Shen Yun“ stehen für den Himmel, den Kosmos bzw. das kosmische Prinzip selbst und für den Rhythmus oder eben, wie in Zhuan Falun beschrieben, für das „Drehen“ des als feinstoffliche Energie vorgestellten „Dharma-Rades“. Der Name ließe sich also auch mit „kosmischer Rhythmus“ oder „Rhythmus des Kosmos“ übersetzen, dem sich die Menschen nach der Lehre von Falun Gong am Ende des Dharma-Zeitalters anzupassen haben, wenn sie nicht verloren gehen wollen. Doch wird der weltanschauliche (und apokalyptische) Aspekt dieser Bezeichnung in der großflächig plakatierten oder digital lancierten Werbung für die Show nirgendwo offen deklariert und kommuniziert. Klarheit besteht nur hinsichtlich der belegbaren Verfolgung von Falun Gong in China, nicht aber hinsichtlich der Heilslehre und apokalyptischen Kosmologie, die selbst für die Mehrheit der nichtchinesischen Praktizieren‐ den kaum bekannt ist. Noch weniger transparent sind die Einnahmen und Finanzströme der Bewegung am Hauptsitz in New York. Diejenigen, die eine Eintrittskarte zu „Shen Yun“ erwerben oder aus gesundheitlichen Erwägungen an den zumeist in Stadtparks ausgerichteten Bewegungsmeditationen von Falun Gong teilnehmen, sollten aber zumindest wissen, dass sie damit zugleich eine metaphysisch und apokalyptisch aufgeladene weltanschauliche Bewegung in ihrem (endzeitlichen) Kampf gegen das kommunistische China unterstützen.
Fußnoten
1 Der Artikel setzt das einführende Stichwort von Friedmann Eißler zu „Falun Gong/Falun Dafa“ aus MdEZW 74,1 (2011), 30–33, fort (jetzt auch im Lexikon für Religion und Weltanschauung der EZW, https://tinyurl.com/5dzx42ad, letzter Abruf aller im Beitrag genannten Internetquellen am 12.6.2025).
2 Der Begriff „Kultivierungspraxis“ ist vornehmlich unter den Anhängern der auf die Kulti‐ vierung von Energie (qi) abzielenden Bewegungsmeditationen des Qigong gebräuchlich.
3 Selbige wird im Daoismus als Metapher für die „Erleuchtung“ oder genauer: für das Einssein mit dem Kosmos verstanden.
4 Heute äußert sich zhong, die traditionelle Loyalität, insbesondere in der Mitgliedschaft in offiziellen „patriotischen Vereinigungen“ (Meyer 2013, 161).
5 Vgl. zu den Internetaktivitäten von Falun Gong ausführlicher Bell und Boas (2003, 278f.) sowie Tong (2002, 640f.).
6 Diese Selbstbeschreibung dürfte Meyer zufolge in der relativ engen Definition von „Religion“ (zongjiao) im heutigen China begründet liegen, nach der „Religion“ als ein institutionell etablierter und über schriftliche Traditionen verfügender „welthistorischer Glaube“ (das sind hier: Buddhismus, Daoismus, Islam, Protestantismus und Katholizis‐ mus) verstanden wird.
7 Epoch Times vom 17.3.2015, zit. nach Tong 2016, 68: „The largest independently-run Chinese television network in the world.“
8 Dies dürfte zumindest für Adressen wie https://www.minghui.org (englisch: https://en.minghui.org, deutsch: https://de.minghui.org) und https://www.zhengjian.org (englisch: https://www.pureinsight.org) der Fall sein.
9 Ausführlicher Xinzhang und Lewis (2020) zur Unterstützung der Epoch Times für den deutschen rechtsextremen Nativismus, der mit diesem Gedanken in Zusammenhang steht.
10 Lin Feng, zit. nach Tong 2016, 74.
11 Vgl. zu den Anpassungsstrategien apokalyptischer religiöser Gruppen nach propheti‐ schen Fehlschlägen im Einzelnen Dawson (2012).
12 Liu Zhan und Zheng Yan Xiong, zit. nach Tong 2016, 75.
13 Demnach stehen die drei Sechsen z.B. für die angeblich 66,6 Millionen Mitglieder der KPC im Jahr 1999 (vgl. Tong 2016, 80f.).
14 Baige, zit. nach Tong 2016, 82.
15 Ming Ao, zit. nach Tong 2016, 81.
16 Baige, zit. nach Tong 2016, 82.
17 Diese gehen nicht allein auf den Ticketverkauf zurück, sondern auch auf großzügige Spenden von Anhängern und Sympathisanten der Bewegung (vgl. Rothfeld und Hong 2024).
18 Vgl. „Ausbeutungs-Vorwürfe gegen Falun Gong und Shen Yun“, SRF, 7.1.2025, https://tinyurl.com/5n6zex3s.
19 „Lawsuit Alleges That Young Dancers for Shen Yun Performing Arts Have Faced Abuse“, CNN, 27.11.2024, https://tinyurl.com/3db3d4s2.
20 „Tanz der Sekte“, ZDF Magazin Royale vom 14.2.2025, Min. 14:30–14:37, https://tinyurl.com/mpjtyauf, mit Bezug auf Hong und Rothfeld (2024).
21 „Stellungnahme zur Darstellung von Falun Gong im ‚ZDF Magazin Royale‘“, FalunDafa Informationszentrum, 27.2.2025, https://tinyurl.com/3wj8pmzc.
22 Kommentar des damaligen Vereinsvorsitzenden Manyan Ng gegenüber dem FOCUS, zitiert nach „Falun Gong. Offizielle Sekte“, FOCUS, 9.5.2005, https://tinyurl.com/mrxsm6mz.
23 „Stellungnahme“ (siehe Anm. 21).
Literatur
Bell, Mark R. und Taylor C. Boas (2003), „Falun Gong and the Internet. Evangelism, Community, and Struggle for Survival“, Nova Religio 6,2, 277–293.
Chang, Maria Hsia (2004), Falun Gong. The End of Days, New Haven: Yale University Press.
Dawson, Lorne (2012), „When Prophecy Fails and Faith Persists“, Nova Religio 3,1, 70–75. Eißler, Friedmann (2011), „Falun Gong/Falun Dafa“, MdEZW 74,1, 30–33.
Fu, Eva (2025), „Wie sich Falun Gong in den 90er-Jahren verbreitete und China veränder‐ te“, Epoch Times, 22.5.2025, https://tinyurl.com/mr2p7ekj.
Hong, Nicole und Michael Rothfeld (2024), „5 Takeaways from The Times’s Coverage of Shen Yun“, New York Times, 30.12.2024, https://tinyurl.com/ycxpyyrw.
Hongzhi, Li (2019), Zhuan Falun (1995) (deutsche Version), Hamburg: F.A.-Verlag, https:/
Malone, Robert (2023), „Concerted Effort of Intelligence Community to Cover Up UFO-Information“, Epoch TV, 28.7.2023, https://tinyurl.com/4avea342.
Meyer, Christian (2013), „Religionspolitik und die Transformation des religiösen Feldes in der Volksrepublik China am Beispiel Falun Gong. Gibt es eine neue ‚Religionspolitik chinesischen Typs‘?“, in: Edith Franke und Katja Triplett (Hg.), Religion und Politik im gegenwärtigen Asien. Konvergenzen und Divergenzen, Berlin: LIT, 141–165.
Ownby, David (2008), Falun Gong and the Future of China, Oxford: Oxford University Press.
Palmer, David A. (2007), Qigong Fever. Body, Science and Utopia in China, London: Hurst.
Peng, Yilang, Tian Yang und Kecheng Fang (2025), „The Dark Side of Entertainment? How Viral Entertaining Media Build an Attention Base for the Far-Right Politics of The Epoch Times“, New Media and Society 27,4, 2087–2108.
Penny, Benjamin (2012), The Religion of Falun Gong, Chicago: University of Chicago Press. Rothfeld, Michael und Nicole Hong (2024), „How Shen Yun Tapped Religious Fervor to
Make $266 Million“, New York Times, 29.12.2024, https://tinyurl.com/bdvsdr67.
Tong, Clement (2016), „Western Apocalyptic Narratives in the International Arena. Falun Gong and the Chinese Apocalypse“, in: Jean-Guy A. Goulet (Hg.), Religious Diversity Today. Experiencing Religion in the Contemporary World, Santa Barbara, Calif.: Praeger, 65–88.
Tong, James (2002), „An Organizational Analysis of the Falun Gong. Structure, Commu‐ nications, Financing“, China Quarterly 171, 636–660.
Werner, Reinhard (2025), „UFOs oder Fehlwahrnehmung? Tausende Seiten bislang geheimer US-Dokumente werfen weitere Fragen auf “, Epoch Times, 29.5.2025, https://tinyurl.com/3ufcxb7c.
Xinzhang, Zhang und James R. Lewis (2020), „The Gods Hate Fags. Falun Gong’s Reactionary Social Teachings“, Journal of Religion and Violence 8,3, 281–297.
Ansprechpartner
 PD Dr. theol. Rüdiger Braun
PD Dr. theol. Rüdiger BraunAuguststraße 80
10117 Berlin