Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der EKD (KMU) nimmt erstmalig auch die religiöse „Großwetterlage“ in den Blick. Ihre Diagnose birgt Überraschungen, die zu Rückfragen Anlass geben.
Triumph der Säkularisierung. Skeptische Rückfragen an die KMU VI
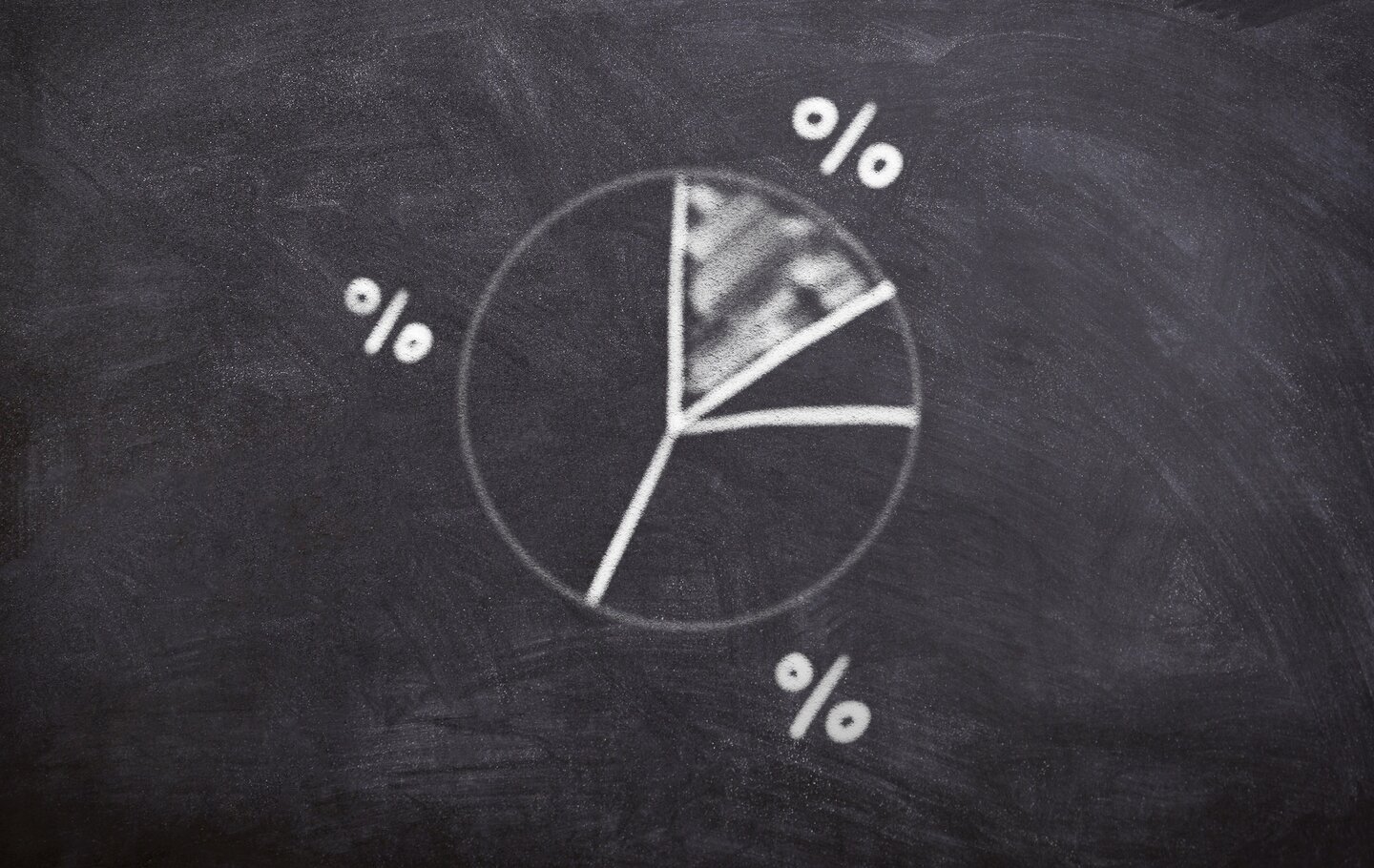
Hier finden Sie die umfangreichere Druckfassung des Artikels (PDF zum Download).
„Die Mehrheit der Deutschen hat mit Religion nur mehr wenig am Hut.“1 Mit diesem lapidaren Satz wurde in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einer der markantesten Befunde der aktuellen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU VI) wiedergegeben, die am 14. November 2023 bei der EKD-Herbstsynode in Ulm mit einer Zusammenschau „erster Ergebnisse“ vorgestellt wurde.2 Im Vorjahr hatten für die demografische Erhebung 5.282 Befragte knapp 600 Fragen beantwortet. Gegenüber den fünf Vorläuferstudien (1972, 1982, 1992, 2002 und 2012) war neu, dass neben protestantischen Kirchenmitgliedern und Konfessionslosen auch katholische Kirchenmitglieder und Angehörige anderer Religionsgemeinschaften befragt wurden.
Damit beansprucht die KMU zum ersten Mal, repräsentative Aussagen über die deutsche Gesamtbevölkerung treffen zu können. Sie nutzt diese Repräsentativität, um erstmalig auch die religiös-weltanschauliche „Großwetterlage“3 in den Blick zu nehmen, in der sich die kirchlichen Entwicklungen vollziehen. Um „die aktuelle Lage der Kirchen besser zu verstehen“, sollte ein Gesamtbild von „Religiosität und Säkularität in Deutschland“ (16) erhoben werden. Das Resultat wird im zweiten Kapitel der Erstauswertung präsentiert. Es birgt Überraschungen.
Das Bild der religiös-weltanschaulichen „Großwetterlage“
Zur Kartografierung der Gesamtlage werden anhand der demografischen Daten und komplexer statistischer Operationen vier Grundtypen religiöser oder säkularer Lebensorientierung (mit jeweils zwei bis drei Subtypen) gezeichnet. Diese vier Typen werden in einem Koordinatensystem mit den beiden Achsen „kirchennahe“ und „kirchenferne Religiosität“ lokalisiert: die „Kirchlich-Religiösen“ (hohe Werte bei kirchennaher Religiosität), die „Alternativen“ (hohe Werte bei kirchenferner Religiosität), die „Säkularen“ (niedrige Werte in beiden Kategorien) und schließlich die Zwischengruppe der „Religiös-Distanzierten“ (mittlere Werte in beiden Kategorien). Auf diese Weise ergibt sich ein plastisches Bild der allgemeinen religiösen Lage in Deutschland.
Bei den meisten Beobachterinnen oder Beobachtern der religiös-weltanschaulichen Landschaft dürften die berechneten Größenverhältnisse freilich für Verblüffung gesorgt haben. So machen laut KMU gerade einmal noch 13 % der Deutschen die „Kirchlich-Religiösen“ aus (zusammengesetzt aus 6 % „Religiös-Geschlossenen“, die sozusagen die Reinform der „kirchennahen Religiosität“ aufweisen, und 7 % „Religiös-Offenen“ mit einer gewissen Affinität zu Aspekten „kirchenferner Religiosität“). Das ist, gemessen an der Zahl der Mitglieder von Kirchen und nichtchristlichen Religionen (insgesamt 57 %), ein enorm geringer Wert. Weniger als ein Viertel der Mitglieder von Kirchen und Religionsgemeinschaften teilen demnach die dort vertretene Religiosität.
Fast noch erstaunlicher als diese Winzigkeit ist die errechnete Marginalität der „Alternativ-Religiösen“. Demnach hängen nur noch 4 % der Deutschen einer „esoterischen“, dazu 2 % einer „hedonistisch-heterodoxen“ Religiosität an (zusammen 6 %).
Geradezu sensationell an der Zusammenschau ist indessen die exorbitante Größe des „säkularen“ Lagers: Ihm werden 56 % zugerechnet, also deutlich mehr als die Hälfte der Deutschen überhaupt und viel mehr als die konfessionslosen Deutschen (43 %), so viele wie in keiner anderen seriösen Untersuchung bisher. Neben den „Säkular-Offenen“ (6 %), bei denen noch gewisse Spuren fluider Religiosität nachzuweisen sind, und den „Indifferenten“ (14 %), denen Religion gleichgültig ist, stellen darin die „Säkular-Geschlossenen“ (36 %) die größte Gruppe dar. Sie hängen laut KMU einer naturalistisch-szientistischen Weltauffassung an und lehnen Religion als etwas Überholtes und/oder Schädliches dezidiert ab. Angesichts des riesigen säkularen Segments bleibt für das „religiös-distanzierte“ Mittelfeld schließlich noch ein Viertel der Bevölkerung (25 %) übrig.
Überraschend viel Säkularität, überraschend wenig Religiosität, so kann man das religionsdiagnostische Resultat der KMU resümieren. Wie kommt die Diagnose eines allgemeinen Rückgangs der Religiosität (und mithin die fulminante Bestätigung der klassischen Säkularisierungsthese vom fortschreitenden Schwund der Religion) in der aktuellen KMU zustande? Bis in umfangreicheren Auswertungsbänden genauere Belege und Explikationen folgen, ist man für diese Klärung auf die Erläuterungen der Erstauswertung angewiesen. Und siehe da: An ihnen fallen einige Ungereimtheiten ins Auge, die Zweifel an der Stichhaltigkeit der Diagnose wecken.
Erhebung ohne Deutung?
Zunächst stolpert man beim Lesen über mehrere Stellen, die das induktive Vorgehen der Untersuchung herausstreichen: „Es ist nicht das Ziel, schon existierende Deutungsmuster zur religiösen Lage lediglich mit Daten illustrieren zu wollen. Die Rekonstruktion der ‚Großwetterlage‘ sollte ohne wesentliche vorausgehende theoretische Richtungsentscheidungen aus den Daten selbst abgeleitet werden“ (16). Damit ist die Frage angesprochen, ob die KMU-Resultate womöglich von bestimmten religionssoziologischen Theorieannahmen präformiert sind, wobei vornehmlich die Alternative von Säkularisierungs- und Individualisierungstheorie im Blick ist. Eine solche Präformation wird in Abrede gestellt, die empirische Objektivität der Ergebnisse festgehalten. Das Typensystem habe sich „aus den Daten selbst“ (16) „induktiv herauskristallisiert“ (17).
Aus dieser Versicherung spricht das Faktizitätspathos quantitativer Sozialforschung. So häufig es begegnet und so sehr es bei vielen verfängt, so wenig ist es zu halten. Daten sprechen niemals für sich, sondern werden gedeutet, wie dick auch immer man die Ableitung „aus ihnen selbst“ unterstreicht. Welche Vorannahmen sich im Falle der Typenbildung der KMU in welcher Weise geltend machen, kann anhand der wenigen Andeutungen über das Verfahren nicht ausgemacht werden. Dass sich solche Vorannahmen geltend gemacht haben, liegt schon deshalb nahe, weil die Fragen oder „Items“, anhand derer sich die Typen nachträglich „herauskristallisiert“ haben sollen, nicht vom Himmel gefallen sind. Sie wurden vielmehr ausdrücklich konstruiert, um bestimmte Gestalten von Religion oder Nichtreligion abzufragen. Daran ist grundsätzlich auch nichts zu beanstanden – es konterkariert nur die Attitüde der deutungslosen und daher objektiven Empirie.
Schon in das Untersuchungsdesign gingen also mannigfache Prämissen ein. Es wird im Übrigen ja auch explizit darauf hingewiesen, dass der KMU-Typenkonstruktion die Matrix einer älteren Erhebung aus der Schweiz zugrunde gelegt wurde.4 „Das gleiche statistische Verfahren wurde ergebnisoffen, d.h. ohne die Schweizer Typologie bereits vorauszusetzen, nun an die Daten der 6. KMU angelegt. Dabei zeigte sich: Auch für Deutschland im Jahr 2022 ergaben sich die entsprechenden Typen“ (18). Diese Korrespondenz ist nicht erstaunlich, erst recht nicht, wenn man bedenkt, dass auch eine ganze Reihe von Fragen aus der besagten Schweizer Studie in der KMU übernommen wurde. Der Identität in der methodischen Anlage entspricht die Identität der in der KMU „gefundenen Typen“ (18).
Mehrdeutige Selbsteinschätzungen
Geht man die Erläuterungen zum Typensystem durch, stößt man zunächst auf die religiöse Selbsteinschätzung der Befragten: Nur wenige stufen sich ausdrücklich als „religiös“ ein und viele (mehr als 30 %) als klar „nicht religiös“. Dies wird gegen die Annahme ins Feld geführt, Religion sei etwas im Wesen des Menschen Verwurzeltes, daher Unverlierbares. Beim Weiterlesen stellt sich Verwirrung ein. Gleich der nächste Absatz räumt nämlich ein, es müsse „auch bedacht werden, was Befragte eigentlich meinen, wenn sie sagen, sie seien (nicht) ‚religiös‘“ (27). In der Tat. Und was meinen sie? Bestimmte Korrelationen mit anderen Items zeigen: „Im Verständnis der Bevölkerung ist das Assoziationsfeld des Begriffs ‚religiös‘ ganz überwiegend kirchlich geprägt. Die semantischen Felder von ‚Religion‘ und ‚Kirche‘ sind eng miteinander verflochten“ (27). Damit ist aber jede allgemeine religionsdiagnostische (oder gar religionstheoretische) Relevanz des Items dahin. Denn offenkundig indiziert die verbreitete Selbsteinschätzung als „nicht religiös“ keine Distanz gegenüber dem, was in den einschlägigen Wissenschaften mit dem Allgemeinbegriff „Religion“ bezeichnet wird, sondern eine Distanz gegenüber kirchlicher Religion. Valide ist das Item als Indiz nicht für das Dahinschwinden, sondern für die Entkirchlichung von Religion. Ob diejenigen, die sich als „nicht religiös“ einschätzen, darüber hinaus eine andere, nichtkirchliche Religiosität pflegen, die sie selbst aufgrund der Assoziation des Begriffs mit dem Kirchlichen niemals als „Religion“ etikettieren würden – die Selbstaussagen verraten es nicht.
Nun könnte man vermuten, Menschen mit einer solchen nichtkirchlichen Religiosität dürften sich mehrheitlich als „spirituell“ charakterisieren, weil der Ausdruck häufig als Alternativbegriff zu „religiös“ Verwendung findet. Um diese Vermutung zu überprüfen, wurden denn auch einige Fragen zur „Spiritualität“ in die Erhebung eingebaut. Der Befund ist ebenfalls dürftig: Der diesbezüglich zentralen Aussage zur „spirituellen Orientierung“ stimmten nur 12 % „voll“ oder „eher“, dafür 19 % eher nicht und 69 % gar nicht zu (vgl. 24). Verknüpft man die Selbsteinschätzungen als „religiös“ und als „spirituell“, ergibt sich, dass sich nur 5 % der Bevölkerung als spirituell, aber (eher) nicht als religiös einstufen. Augenscheinlich versagt der Spiritualitätsbegriff damit weitgehend als Indikator einer nichtkirchlichen Religiosität. „Eine große Mehrheit der Bevölkerung (68 %) erachtet sich weder als religiös noch [als] spirituell“ (25). Das scheint nun doch den allgemeinen Religionsschwund recht deutlich zu belegen.
Bei genauerem Hinsehen stellen sich die Dinge weniger eindeutig dar. Das maßgebliche Item lautet: „Ich bin ein spirituell orientierter Mensch mit einer Verbindung zu einer höheren Wirklichkeit“ (24). Diese Aussage ist steil. Denn der Zusatz „mit einer Verbindung zu einer höheren Wirklichkeit“ erregt leicht die Assoziation einer persönlichen „Verbindung“ samt Kommunikation mit höheren Mächten, die dann irgendwie auf das Leben einwirken. Es liegt relativ nahe, dabei an magische oder spiritistische Praktiken zu denken. Der Zusatz gibt der Aussage einen deutlichen Bias in Richtung Esoterik – und verdirbt sie damit als Indikator für nichtkirchliche Religiosität überhaupt.5
Gotteskrise und Kirchenkrise
Ein weiterer zentraler Beleg der KMU-Erstauswertung für die fortgeschrittene Erosion der Religion ist die gemessene (Nicht-)Zustimmung zu konkreten Gottesvorstellungen. Dabei wird zuerst „der Verlust eines traditionellen Gottesglaubens“ (33) thematisiert, der mit folgender Aussage abgefragt wurde: „Ich glaube, dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat“ (33). Dem stimmten 19 % der Gesamtbevölkerung zu, unter evangelischen Kirchenmitgliedern 29 % und unter katholischen 32 %.
Das bedeutet: Zwei Drittel der Kirchenmitglieder teilen ein auf Jesus Christus bezogenes Gottesbild nicht oder fühlen sich in so großer Distanz zu dieser Glaubensaussage, dass sie sie nicht ankreuzen. Das kann man als Indiz dafür werten, dass derzeit nicht nur eine Krise der Kirche als Organisation zu beobachten ist, sondern der tradierte christliche Gottesglaube selbst in eine Krise geraten ist (33).
Die KMU-Auswertung veranschlagt die Tatsache, dass zwei Drittel der Kirchenmitglieder die zitierte Aussage über den in Jesus Christus erkennbaren Gott nicht bejahen, umstandslos als Element der Kirchenkrise. Im Hintergrund steht offensichtlich die Überzeugung: Eine verbreitete Distanz zu den überlieferten Grundfesten des Glaubens bedeutet eine innere Erosion, der die äußere zwangsläufig folgen muss: „Die Lösung institutioneller Bindungen zur Kirche und der Verlust eines traditionellen Gottesglaubens gehen Hand in Hand“ (33).
Diese Schlussfolgerung ist ein Augenöffner, und zwar hinsichtlich der leitenden Schemata der Auswertung. Sachlich viel naheliegender wäre nämlich die entgegengesetzte Schlussfolgerung: Wenn zwei Drittel der Kirchenmitglieder jene traditionelle Gottesvorstellung nicht bejahen, dann zeigt das: Man kann Kirchenmitglied sein, ohne den traditionellen Glauben bruchlos zu teilen. Also scheint der „Verlust eines traditionellen Gottesglaubens“ gerade nicht zwangsläufig mit der Lösung von der Kirche einherzugehen. Dieser Schluss drängt sich nur dann auf, wenn man das ekklesiologische Leitbild einer Gemeinschaft von Glaubenden mit einem traditionell ungebrochenen, konfessionell einheitlich definierten Glauben in Ansatz bringt. Aber dieses Leitbild ist so anachronistisch wie fatal, weil es die Kirche in einen fundamentalen Gegensatz zu den traditionskritischen Bedingungen der Gegenwart setzt. Unter den Gründen, die traditions- und konfessionsdistanzierte Kirchenmitglieder zur Ablösung treibt, dürfte daher besagtes Leitbild nicht an letzter Stelle stehen. Denn es stempelt sie zu „heterodoxen“ Kirchendistanzierten und vermittelt ihnen das Gefühl, nicht vollwertig dazuzugehören. Das traditionalistische Kirchenideal wird leicht zur self-fulfilling prophecy der Kirchenkrise. Darum ist zu befürchten, dass auch die KMU mit ihrer engen Bestimmung des „Kirchlich-Religiösen“ entsprechende Wirkungen entfaltet.
Theologische Zustimmungshürden
Nun werden manche einwenden, wenigstens bei den basics des christlichen Gottesbildes sei doch eine gewisse Übereinstimmung bei den Kirchenmitgliedern durchaus zu erwarten. Aber auch wenn man dies einräumt – ist das gleichbedeutend mit der Zustimmung zu der einschlägigen Aussage „Ich glaube, dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat“ (33)? Das Item ist das einzige innerhalb der KMU, das eine spezifisch christliche Religiosität indiziert. Es fungierte daher bei der Typenbildung offenbar als einer der ausschlaggebenden Marker für die Zugehörigkeit zu den „Kirchlich-Religiösen“ (95 % von ihnen stimmen zu). Aber dafür ist es wiederum viel zu steil formuliert. Wieso steil?, werden Theologinnen und Theologen fragen, das ist doch eine konzise Zusammenfassung des christlichen Gottesbildes! Ja, nämlich sofern man sich an die offenbarungstheologischen Formeln zünftiger Theologie gewöhnt hat. Wie viele fromme, aber theologisch „unstudierte“ Christenmenschen würden sich so abstrakt äußern? Und wie viele von ihnen würden diesem Satz, den sie selbst nie so formuliert hätten, zustimmen, wenn man sie danach fragt? Gott, der Unsichtbare, Unendliche, Unbegreifliche soll sich in dem Menschen aus Nazareth „zu erkennen“ gegeben haben? Sollte das möglich sein? Und wenn ja, inwiefern und inwieweit? Genügt es nicht, mit Jesus an den liebenden Vater im Himmel zu glauben, der trotzdem in vielem „unerkannt“ bleibt? Wer solche Zweifelsfragen stellt und sich daher scheut, den Satz unerläutert für „zutreffend“ zu erklären, ist nach der KMU so gut wie raus aus dem kirchlichen Christentum.
Bei alledem war bislang von der Problematik von Existenzsätzen in Bezug auf Gott noch gar nicht die Rede. „Einen Gott, den ‚es gibt‘, gibt es nicht“, hat Dietrich Bonhoeffer herausgestellt,6 weil das Prädikat der „Existenz“ generell an sinnliche Wahrnehmbarkeit geknüpft ist. Sollte dieser philosophisch-wissenschaftlich höchst berechtigte Vorbehalt nicht manche aufgeklärten Zeitgenossen davon abhalten, überhaupt eine der vorgeschlagenen Existenzaussagen gegenzuzeichnen,7 obwohl sie sich als religiöse Menschen durchaus auf eine irgendwie „göttliche“ oder transzendente Dimension der Wirklichkeit richten? Wenn es um die Alternative geht zwischen der (Nicht-)Existenz eines Gottes, „der sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat“, und der (Nicht-)Existenz eines „höheren Wesens“ bzw. einer „geistigen Macht“, sollte sich da nicht der eine oder die andere in eine aporetische Lage gebracht fühlen? Immerhin hat in dieser Situation die vierte Antwortoption einen aufrichtigen Ausweg geboten: „Ich weiß nicht richtig, was ich glauben soll“ (34; 20 % Zustimmung).
Ausschluss von Ambiguität
Es lässt sich festhalten, dass die Ergebnisse der Items zu den Gottesvorstellungen insgesamt weniger eindeutig sind als von der KMU-Auswertung insinuiert. „Empirisch eindeutig“ (vgl. 25) ist eigentlich nur dreierlei: Erstens ist die Geltung eines theistischen und zusätzlich offenbarungstheologisch bestimmten christlichen Gottesbegriffs begrenzt, innerhalb wie außerhalb der Kirche. Zweitens herrscht eine große (und der Thematik höchst angemessene) Reserve gegenüber der Existenzbehauptung in Bezug auf etwas „Göttliches“. Drittens besteht ansonsten eine große (und der Thematik höchst angemessene) Unsicherheit hinsichtlich der Gottesfrage. Ist von diesem dreifachen Befund auf einen fortgeschrittenen Religionsschwund zu schließen? Wohl nur dann, wenn man authentische Religiosität an die entschiedene Bejahung philosophisch und theologisch zweifelhafter Existenzaussagen knüpft. Es hängt also nicht zuletzt an der Einschätzung bezüglich der Verbreitung und lebensweltlichen Durchschlagskraft kritischer Bildung unter den Deutschen.
Manches spricht dafür, dass deren Wirksamkeit seit der Wiederentdeckung der Kritik durch die Generation der „1968er“ zugenommen hat. Sollte dies zutreffen, muss freilich auch dies nicht bereits von sich aus für ein Abschmelzen der Religion überhaupt sorgen. Denn mit dem neuen Durchbruch traditionskritischer Haltungen ging in den 1970er und 1980er Jahren ja eine Konjunktur neuer Religionsformen einher. Was aus dieser großenteils nichttheistischen Religion inzwischen geworden ist, lässt sich aus der Frage nach der „Existenz“ göttlicher Entitäten nicht ermitteln.
Indessen sind mit dem Allgemeinwerden der Traditionsdistanz in jedem Fall die Hürden für eine ungebrochene Zustimmung zur christlichen Tradition gestiegen. Dem entspricht der Befund, dass der Kreis derer, die einen traditionellen (und zudem offenbarungstheologisch enggeführten) christlichen Theismus teilen, klein geworden ist. Die Mehrzahl der Menschen, innerhalb wie außerhalb der Kirche, teilt ihn nicht mehr ohne Weiteres.
Die Frage, ob sie damit dem Christentum noch zugehören können oder ihm bereits verloren gegangen sind, kann hier nicht breiter diskutiert werden. Nur so viel: Es ist auch eine christliche Religiosität mit oszillierenden Gottesvorstellungen denkbar. Sie zeichnete sich dadurch aus, dass in bestimmten religiösen Akten eine „momentane“ theistische Vorstellung aufgerufen wird, etwa im Augenblick des Gebets oder beim Singen eines Chorals, ohne dass sich das religiöse Subjekt zu einer entsprechenden Existenzaussage durchringen könnte, weil es auf der Ebene seiner philosophischen Vernunft um den Anthropomorphismus und mithin um die Inadäquatheit jener Gottesvorstellung weiß. Theologen wie Friedrich Schleiermacher oder Paul Tillich waren der gut begründeten Ansicht, eine derartige Ambiguität sei im religiösen Bewusstsein unter den Bedingungen der Moderne nicht nur möglich, sondern unumgehbar.
Alte Zerrbilder
Votiert man für jene mit den Namen Schleiermacher und Tillich angesprochene religionstheologische Option, ist damit wohlgemerkt nicht gesagt, dass die Gesamtbevölkerung durchweg einem „anonymen Christentum“ (Karl Rahner) zugeschlagen und sonach kurzerhand kirchlich vereinnahmt würde. Das ist ein beliebtes Zerrbild von Religionstheologie und Individualisierungstheorie, das im Zusammenhang der KMU-Vorstellung prominent erneuert wurde.8 Wenn Theologinnen und Theologen mit (übrigens nicht weniger prominenten) Teilen der Religionssoziologie davon ausgehen, dass die moderne Emanzipation des Individuums von den religiösen Institutionen einen Freiraum geschaffen hat, in dem neue Gestalten individualisierter, fluider und wenig normierter Religiosität entstanden sind, wird ihnen immer wieder dreierlei unterstellt: Sie wollten damit (1) die ungebrochene und a priori unzerstörbare Vitalität der menschlichen Religiosität behaupten, die sie (2) als dem institutionellen Christentum in jeder Hinsicht gleichwertig betrachteten, um damit (3) „ein anthropologisches Auffangnetz für kirchliches Handeln“ aufzuspannen – so die KMU-Auswertung (38) –, indem sie nämlich das Gedeihen von Religiosität von der Qualität dieses Handelns abkoppelten.
Dem ist zu entgegnen: Bei der theologischen Aufnahme der Individualisierungstheorie geht es nicht um die Beschönigung der religiösen Lage und die Entlastung kirchlichen Handelns, sondern um das Ausloten von Anschlussmöglichkeiten dieses kirchlichen Handelns an ein vorhandenes Reservoir an religiösen Zuständen, Haltungen und Praktiken. Daraus leitet sich dann die Aufforderung zu zeitgemäßen kirchlichen Vermittlungsbemühungen ab. Sollte es die Kirche für ihre religiöse Kommunikation nicht interessieren, was für religiöse Fragen und Antworten bei den Menschen kursieren, die sie ansprechen will (um ein Schema Tillichs aufzugreifen)? Könnte es nicht eine ihrer Schlüsselaufgaben sein, vorhandene Aspekte von Religiosität aufzunehmen, wie nahe dem Christentum auch immer, und sie mithilfe des Schatzes christlicher Gehalte und Symbole zu neuer Bestimmtheit zu bringen, um ihnen auf diese Weise eine neue heilsame Qualität und lebensbestimmende Kraft zu verleihen?
Bei denen, die diese Fragen bejahen, schwingt teils durchaus die Sorge mit, dass die fluide Religiosität der Gegenwart ohne symbolische Bestimmtheit und institutionellen Außenhalt bis zur gänzlichen Unsichtbarkeit dahinschwinden könnte. Wer die mannigfachen Gestalten individualisierter Religion wahrnimmt, muss damit nicht die prinzipielle Unmöglichkeit von Säkularisierung behaupten; er oder sie muss auch nicht leugnen, dass tatsächlich eine partielle Schwächung der Religion stattfindet, selbst wenn er oder sie der Annahme einer menschlichen Anlage zur Religion zuneigt: Auch Anlagen können schließlich verkümmern.
Jene Frage nach menschlichen „Anknüpfungspunkten“ kirchlicher Rede wurde von einem berühmten Theologen des 20. Jahrhunderts bekanntlich mit einem donnernden „Nein!“ quittiert, das heute noch in Vorbehalten gegenüber der Aufgabe theologischer Vermittlung nachhallt – und in den Vorbehalten gegenüber der Individualisierungsdiagnose.9 Aber es ist nun einmal so: Wenn sich Theologie und Kirche nicht um die Anschlussfähigkeit und Vermittlung des Christlichen kümmern, wird selbiges weniger Resonanz finden. Das Ideal eines vermittlungslosen Verkündigungsauftrags ist die self-fulfilling prophecy der Kirchenschrumpfung.
Der Rückgang religiöser Praxis
Der allgemeine Schwund der Religiosität in Deutschland wird in der KMU-Auswertung nicht nur an der Krise der Gottesvorstellungen, sondern auch am Schwund religiöser Praxis festgemacht. Abgefragt wurden das Beten, die Bibellektüre, das Praktizieren „einer religiösen oder spirituellen Meditation“, das „Fasten aus religiösen Gründen“, die Teilnahme an Pilger- oder Wallfahrten sowie an religiösen Großveranstaltungen (der Gottesdienstbesuch, so kann man ergänzen, ist ohnehin rückläufig). Das Ergebnis: „Im Großen und Ganzen ist davon auszugehen, dass etwa 15–20 % der Bevölkerung einer regelmäßigen religiösen Praxis nachgehen“ (35).
Man stutzt: Aus einem Item-Set, das weit überwiegend aus typisch kirchlichen Praktiken besteht, wird eine allgemeine Quote religiöser Praxis errechnet.10 Die einzigen Ausnahmen sind die „religiöse oder spirituelle Meditation“, womöglich das Fasten, vielleicht noch die religiösen Großveranstaltungen. Es wird dann noch ein Item hinzugefügt, das aufschlussreich ist: „Das gelegentliche ‚Anzünden einer Kerze aus religiösen Gründen‘ fällt mit 34 % Zustimmung höher aus“ (35).
An diesem Item, das eine Gestalt unbestimmter und unscheinbarer Religion in den Blick nimmt, wird sogleich offenbar, wie eng das Feld religiöser Praxis ansonsten gefasst ist. Schlägt man Kristian Fechtners Erkundungen spätmoderner Frömmigkeit11 auf, die ausdrücklich erwähnt werden, kann man ersehen, dass bei einem weiteren Zuschnitt des Begriffs auch die Quote für die religiöse Praxis deutlich höher ausgefallen wäre. Der Umgang mit Engelsfiguren und Amuletten, das Aufstellen von Unfallkreuzen, das touristische Verweilen in Kirchen, der ganze Bereich von Kirchenmusik und anderen Formen religiös konnotierter Musikpraxis, überhaupt verschiedene Gestalten von „Kunstreligion“,12 das Advents- und Weihnachtsbrauchtum – all dies sind Praktiken, die mindestens als religionsaffin eingestuft werden können, weil sie entsprechende religiöse oder spirituelle Assoziationen mit sich führen.
Aber man versteht auch, warum dieser Bereich spiritueller Praxis in der KMU weitestgehend ausgespart bleibt. Es wäre methodisch zu aufwändig gewesen, ihn in seiner ganzen Breite abzufragen – es hätte dazu Dutzende weiterer Fragen bedurft. Und eigentlich hätte es dazu auch einer anderen Methode bedurft. Denn im Blick auf die spirituelle Praxis öffnet sich ein Feld, bei dem die Übergänge zwischen „religiös“ und „nicht religiös“ oftmals verschwimmen – nach Kristian Fechtner und anderen eines der Schlüsselmerkmale individualisierter Religiosität. Ein expliziter und durchgängiger „Transzendenzbezug“, für die KMU das ausschlaggebende Definitionsmerkmal echter Religion, ist dabei nicht immer eindeutig auszumachen. Die Dinge oszillieren, und ihre Identifikation ist ein hermeneutischer Akt, der strittig bleiben muss. Solche Unschärfen sind für die quantitative Sozialforschung eine Zumutung – man könnte sie auch nur mit qualitativen Methoden adäquat fassen.
Der Preis empirischer Schärfe, verbunden mit der Not methodischer Begrenzung, ist phänomenale Enge. Anscheinend sind im Zusammenhang der religiösen Praxis auch esoterische Praktiken nicht berücksichtigt, die in der KMU berührt werden, nämlich Astrologie und Wahrsagerei.13 Hier und in der KMU überhaupt fehlt der ganze Bereich neuerer esoterischer Praktiken: Tarot, Hexenrituale, Räucherzeremonien, „Manifestieren“, Heilsteine, neopagane Naturkulte (Sonnwendfeiern, Raunachtrituale etc.), spirituelle Coaching- und Satsang-Treffen usf. Man sieht: Ein repräsentatives Bild der religiösen Großwetterlage lässt sich nicht im Rahmen einer Großuntersuchung mit anderen Schwerpunkten, gewissermaßen „nebenbei“, gewinnen.
Der Rückgang religiöser Erfahrung
Um übermäßiger Verengung zu entgehen, versucht die KMU, neben den religiösen Überzeugungen (über die Existenz des Göttlichen) und Praktiken auch religiöse Erfahrungen zu erfassen, wiederum mit relativ mageren Ergebnissen:
Auf der Erfahrungsebene ist das Spüren der Wirksamkeit einer transzendenten Realitätsebene bei Minderheiten in unterschiedlichen Graden verbreitet. Der Aussage „Ich spüre Gottes Gegenwart in meinem Leben“ stimmten 22 % zumindest eher zu, 21 % haben „schon erlebt, dass spirituelle Kräfte in meinem Leben eine Wirksamkeit entfalteten“, 24 % hatten „bei manchen Naturerlebnissen schon das Gefühl, eine heilige Macht zu spüren“. Die Erfahrung, „dass dunkle Mächte auf mein Leben einwirken“, haben 8 % gemacht. Bei Religiös-Offenen und Esoterischen treten solche Erfahrungen am häufigsten auf, bei Säkular-Geschlossenen quasi nie (35).
Religiöse Erfahrung wird als „Spüren“ der „Gegenwart“ oder „Wirksamkeit“ Gottes, „spiritueller Kräfte“, „heiliger“ oder „dunkler“ „Mächte“ gefasst. Einmal mehr gilt: Diese Bestimmungen sind steil – wen sollte es wundern, dass sich nur „Minderheiten“ entsprechende Erfahrungen zuschreiben? Sie sind steil, insofern sie auf ein quasi leibliches Erleben („Spüren“) manifester Wirkungen von übernatürlichen Kräften oder Mächten abheben. Religiöse Erfahrung wird damit archaisiert. Sie wird auf ausgesprochen vormoderne Weise gefasst, mit dem wenig überraschenden Resultat, dass sie unter modernen Bedingungen kaum noch vorkommt.
Allenfalls das „Spüren der Gegenwart Gottes in meinem Leben“ kann man mit etwas gutem Willen spiritualisiert verstehen; alle anderen Items verlangen die Sistierung eines modernen Weltverhältnisses, in dem solch manifeste Begegnungen mit transzendenten Realitäten nicht vorgesehen sind. Zweifellos gibt es religiöse Strömungen, in denen derartige Machterfahrungen dennoch an der Tagesordnung sind, man denke nur an das Pfingstchristentum. Aber sie sind, jedenfalls was Europa angeht, eben nur für Minderheiten zugänglich, denen es gelingt, für ihre Frömmigkeit aus dem „entzauberten“ Normalbewusstsein des Alltags immerhin zeitweise auszusteigen. Für die meisten Europäerinnen und Europäer verbieten sich solche handfesten Beschreibungen religiösen Erlebens.
Ist das nun nicht gerade eine Bestätigung der Säkularisierungsannahme, dass in der „entzauberten Welt“ (Max Weber) der Moderne die Religion an den Rand gedrängt wird? Die Antwort ist nein. Denn religiöse Erfahrung lässt sich auch weniger handgreiflich beschreiben: Die moderne Religionstheologie und Religionsphänomenologie bieten viele entsprechende Konzeptionen. Beispielsweise hegen Menschen beim Anblick von Landschaften, beim Hören von Musik oder beim Betrachten von Gemälden Gefühle von Dankbarkeit oder Trost, von Ehrfurcht, Erhabenheit oder Heiligkeit, und manche würden solche seelischen Tiefenerlebnisse sogar als religiös qualifizieren. Aber „das Gefühl, eine heilige Macht zu spüren“? Das klingt für viele nach Schwärmerei oder Okkultismus.
Die Zunahme säkularer Orientierungen
Ein besonders gewichtiges Argument für die Annahme der allgemeinen Religionsmisere ist für die KMU-Auswertung schließlich die „Ausbreitung säkularer Orientierungen“ (36). Selbige wird von der KMU auch enorm hoch angesetzt: Das gesamte Segment der Säkularen fällt knapp fünfmal größer aus als in der Schweizer Vorläuferstudie von 2014 (Datenerhebung 2008/09), der harte Kern der „Säkular-Geschlossenen“ ist sogar mehr als zehnmal so groß.14 Das ist eine frappante Größendifferenz. Sollten die Schweizer vor neun Jahren wirklich dermaßen anders getickt haben als die Deutschen heute? Der soziologische Laienverstand sagt: Da kann etwas nicht stimmen! Und fragt weiter: Mit welchen Items wurden die „Säkularen“ denn als solche identifiziert?
Ausschlaggebend war dafür die Kombination eines negativen und eines positiven Moments. Es musste sich eine „religionsablehnende“ Haltung mit einer szientistisch-naturalistischen Einstellung verbinden. Die Religionsaversion wurde mit folgenden Items gemessen: (1) „Das moderne wissenschaftliche Weltbild hat Religionen überflüssig gemacht“ (42 % Zustimmung); (2) „Alles in allem schadet Religion der Menschheit mehr, als sie nützt“ (44 %); (3) „Mir selbst sind religiöse Fragen bedeutungslos und egal“ (55 %); (4) „Es befremdet mich und macht mich misstrauisch, wenn Menschen sehr religiös sind“ (57 %).
Bei der Deutung der Befragungsergebnisse wiederholen sich die Probleme, die schon bei der religiösen Selbsteinschätzung auftauchten. Dort zeigte sich, dass ein großer Teil der Befragten beim Begriff „Religion“ an kirchliche Religion denkt, die institutionell und dogmatisch gebunden ist. Tatsächlich korreliert auch bei den oben angeführten Items das Antwortverhalten stark negativ mit der kirchennahen Religiosität, aber nur schwach negativ mit der kirchenfernen Religiosität. „Das bedeutet, dass der Gegenpol des Säkularismus in erster Linie die Kirchen sind, weniger andere Religionsformen“ (36). Das wiederum bedeutet aber, dass es sich gar nicht um „Säkularismus“ im Sinne von genereller Religionsgegnerschaft handelt, sondern um eine Ablehnung kirchlicher Religion. Das ist ein signifikanter Unterschied, der in der plakativen Typologie unterschlagen wird.
Um die betreffenden Aussagen klar zuordnen zu können, müsste man im Übrigen wissen, was die Leute dabei denken. Item (1) kann ohne Weiteres so gelesen werden, dass die Religion durch die Wissenschaften als Welterklärungsinstanz überflüssig geworden ist – und welche gebildete Europäerin, die Tag für Tag den wissenschaftlichen Erklärungen der Welt folgt, wollte dem widersprechen? Item (2) kann leicht im Sinne einer Konfliktträchtigkeit von Wahrheitsansprüchen verstanden werden, die sich absolut setzen – und welcher human gesinnte Mensch mit Kenntnis der Religionskriege in Geschichte und Gegenwart würde dieser Aussage nicht zuneigen? Bei Item (3) stellt sich die Frage, was mit „religiösen Fragen“ gemeint sein könnte – für viele wohl die strittigen Einzelfragen kirchlicher Dogmatik, die ihrer nachvollziehbaren Ansicht nach für das Leben keinerlei Relevanz besitzen. Item (4) schließlich dürfte eine verbreitete Reserve gegenüber einem „Zuviel“ an Religiosität ansprechen, das den Umgang mit Mitmenschen bekanntlich sehr erschweren kann. Es bestätigt sich: Wenig spricht dafür, die Zustimmung zu diesen Aussagen als Ausdruck genereller Religionsgegnerschaft zu gewichten. Sie haben daher auch unter „Kirchennahen“ in Teilen Zustimmung gefunden.
Wie sieht es mit der Bemessung der Positivkomponente aus? Zwei einschlägige Items für eine naturalistische Einstellung werden genannt: (1) die Ablehnung der Aussage „Ich glaube an ein Leben nach dem Tod“; (2) die Zustimmung zu der Aussage „Eine vom Körper unabhängige Seele gibt es nicht, alles läuft streng nach den bekannten Naturgesetzen ab“ (vgl. 36). Was die zweite Frage angeht, hätte man gerne genaueren Einblick in die Korrelationen – auch die Bildungsforschung müsste sich dafür interessieren. Welcher gebildete Europäer würde ohne Weiteres behaupten, es „gebe“ eine „vom Körper unabhängige Seele“? Dass es so etwas „gibt“, war zuletzt im 18. Jahrhundert gängige Meinung – bis Kant dieser Vorstellung in der Kritik der reinen Vernunft (1781) als wissenschaftlicher Ansicht den Garaus gemacht hat. Man würde auch gerne wissen, wie evangelische Theologinnen und Theologen hier votiert hätten. Denn die These vom „Ganztod“ des Menschen samt der an den Leib gebundenen „Seele“ ist spätestens seit Eberhard Jüngels Buch Tod (1971) im Grunde die communis opinio der Zunft.15 Die Theologenschar: nach der KMU eine Bande von Naturalistinnen und Szientisten – wenn das nicht ein gewichtiges Indiz für den Niedergang der Religion ist …
Es bleibt als ernstzunehmendes Item die Ablehnung des Glaubens an ein Leben nach dem Tod. Ob dabei die Zuordnung zum „Naturalismus“ schlüssig ist, kann hier dahingestellt bleiben. Jener Glaube ist ein starkes Attraktionsmoment des Christentums – und ein Moment starker Abstoßung. Aber als Indikator für eine generelle antireligiöse, „säkularistische“ Orientierung taugt er nicht, weil es selbstverständlich Religion ohne den Glauben an ein individuelles postmortales Fortleben gibt. Der in der KMU-Auswertung gebrauchte „Säkularismus-Index“ hat sich sonach als ein ziemlich unsolides Konstrukt erwiesen. Damit erklärt sich und relativiert sich die sensationelle Übergröße der betreffenden Gruppe. Es müssten plausiblere Items gefunden werden, um sie neu zu bestimmen und zu bemessen.
Kritische Bilanz
Die Lektüre der KMU-Erstauswertung hat an ihrem allgemeinen religionsdiagnostischen Vorspann gravierende Plausibilitätsdefizite methodischer und inhaltlicher Art aufgewiesen.16 Mit dem Versuch, ihre neue Repräsentativität für ein Bild der religiösen „Großwetterlage“ auszumünzen, wurde die KMU offenkundig überfrachtet.
Die Verantwortlichen wollten zu viel, methodisch und inhaltlich. So steht die Selektivität der Items in einem Missverhältnis zum umfassenden diagnostischen Anspruch. Man kann nicht aus gesunkenen Absatzzahlen bei Opel auf den Niedergang der Automobilindustrie schließen. Zudem sind viele der Items schlicht unglücklich formuliert – teils zu eng, teils zu mehrdeutig, um den Indikatorenwert, der ihnen zugewiesen ist, jeweils erfüllen zu können. Die Verantwortlichen wollten aber, so scheint es, auch inhaltlich zu viel. Es zeigte sich an mehreren Stellen, dass die Argumentation (teils auch in ihrer Widersprüchlichkeit) nur anhand säkularisierungstheoretischer Vorannahmen nachvollziehbar ist. So entsteht – trotz gegenteiliger Versicherungen – immer wieder der Eindruck, es sollten diese Vorannahmen empirisch nachgewiesen werden. Möglicherweise haben sie sich aber auch unbewusst geltend gemacht. In beiden Fällen bleibt die Wahrnehmung einer mangelhaften Kontrolle der eigenen Voreingenommenheit.
Von allen Defiziten grundsätzlich untangiert bleibt das vielfach gut belegte Resultat einer massiven Entkirchlichung der Religion in Deutschland. Allerdings wird das Maß dieser Entkirchlichung durch die allzu enge Auffassung des „Kirchlich-Religiösen“ deutlich übersteigert. Schon die naheliegende Einbeziehung der „Distanziert-Kirchlichen“ in diesen Sektor hätte die Größenverhältnisse signifikant verschoben (von 13 % auf 21 %). Würde man die Indikatoren für kirchliche Religiosität mit mehr Sinn für Spielräume und Ambiguitäten neuzeitlichen Christentums formulieren, dem Anspruch von „Volkskirchlichkeit“17 gemäß, wären vermutlich noch einmal andere Zahlen zu erwarten. Am prinzipiellen Befund der weitgehenden Entkirchlichung änderte sich dadurch zwar nichts. Aber es entstünde ein realistischeres Bild vom quantitativen Potenzial und von der legitimen Diversität des kirchlichen Christentums von heute.
Aus angemesseneren Variablen würden auch ansonsten andere Größenverhältnisse resultieren: ein deutlich kleinerer Sektor der Säkularität und deutlich größere Sektoren der Esoterik und des fluiden religiösen Mittelfeldes. Würde man die an sich schon nicht unproblematische Basislogik der Typologie überdenken, das Gesamtfeld der Religiosität durch die beiden Achsen „Kirchennähe“ und „Kirchenferne“ zu definieren, stellte sich die „Großwetterlage“ noch einmal ganz anders dar. Damit würde vielleicht auch die für das religiöse Handeln der Kirche immens hemmende Wirkung der mutmaßlichen Fehldiagnose aufgehoben, dass „die Mehrheit der Deutschen mit Religion nur mehr wenig am Hut hat“.
Was bleibt?
Was also bleibt von der allgemeinen Lagebeschreibung der KMU? Das werden die ausführlicheren Auswertungen zeigen, die noch zu erwarten sind. Allerdings stehen die Aussichten nicht sonderlich gut, weil sich die misslungene Item-Konstruktion nachträglich nicht heilen lässt. Es wäre daher schon viel gewonnen, würde sich die Einsicht in die begrenzte Aussagekraft der infrage stehenden KMU-Befunde durchsetzen, auf dass selbige nicht allzu lange die Debatten über die Religiosität in Deutschland und die strategischen Überlegungen zur künftigen Kirchenentwicklung bestimmen.
Noch mehr wäre gewonnen, würden die nachgezeichneten Probleme bei der nächsten Ausgabe der KMU berücksichtigt, etwa indem man das Methodenarsenal um qualitative Elemente erweiterte. So könnte die Untersuchung eher einen produktiven Beitrag zur Beschreibung des gegenwärtigen religiösen Wandels leisten. Zweifellos sind Christentum und Kirche in Deutschland in einer Krise; und auch um die Religion überhaupt stand es vermutlich schon einmal besser. Außer Frage steht auch, dass sich Religion, Christentum und Kirche in dieser Krise rasant verändern. Für eine handlungsleitende Diagnose genügt es aber nicht zu sagen, dass es nicht mehr so ist wie früher. Man muss den Blick schärfen für die weiterbestehenden und für die neuen Lebens- und Darstellungsformen von Religion und Christentum. Das würde der Kirche dabei helfen, nicht in Panik oder Depression zu verfallen, sondern den Wandel wohlgemut und zukunftsoffen mitzugestalten.
Martin Fritz
Eine ausführlichere Fassung des Artikels erscheint in Heft 1/2024 der „Zeitschrift für Religion und Weltanschauung“.
Literatur
Anselm, Reiner/Merle, Kristin/Pohl-Patalong, Uta (2023): Wie hältst du’s mit der Religiosität? Eine kritische Perspektive auf die soeben erschienene Überblicksdarstellung der KMU VI, zeitzeichen 24/12 (2023), 52-55 (online am 14.11.2023: https://zeitzeichen.net/node/10806).
Barth, Karl (1934): Nein! Antwort an Emil Brunner, in: Fürst, Walther (Hg.): „Dialektische Theologie“ in Scheidung und Bewährung 1933–1936. Aufsätze, Gutachten und Erklärungen, München: Kaiser, 1966, 208–258.
Bingener, Reinhard (2023): Kirchen am historischen Kipppunkt. Eine großangelegte Untersuchung zur Bindung an die Kirchen zeigt dramatische Entwicklungen auf, F.A.Z., 15.11.2023, 8.
Bonhoeffer, Dietrich (1930): Akt und Sein. Transzendentalphilosophie und Ontologie in der systematischen Theologie, 3. Aufl., München: Kaiser, 1964.
EKD (2023): Wie hältst du’s mit der Kirche? Zur Bedeutung der Kirche in der Gesellschaft. Erste Ergebnisse der 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, Leipzig: EVA (Download unter https://www.ekd.de/ergebnisse-der-6-kirchenmitgliedschaftsuntersuchung-80962.htm).
Fritz, Martin (2019): Selbstkritische Affirmation. Tillichs „protestantisches Prinzip“ als Kennzeichen pluralismusfähiger Religion, in: Asmar, Raymond u.a. (Hg.): Reformation und Revolution im Denken Paul Tillichs, Tillich Research 18, Berlin: de Gruyter, 131–172.
Fritz, Martin (2020a): Säkularisierung, Pluralisierung, Radikalisierung. Die neue Unübersichtlichkeit der religiösen Lage in Europa, in: Dittmer, Jörg/Kemnitzer, Jan/Pietsch, Michael (Hg.): Christlich-jüdisches Abendland? Perspektiven auf Europa, Stuttgart: Kohlhammer, 289–308.
Fritz, Martin (2020b): Sozialformen des protestantischen Christentums, MdEZW 83,1, 66–73 (hier online).
Fritz, Martin (2023): Kunstreligion, ZRW 86,3, 222–231 (hier online).
Pollack, Detlev (2023): Theologen auf dem Holzweg. Ein liberaler Mythos zerbricht. Christentum als außerkirchliche Religiosität funktioniert nicht. Eine neue Untersuchung der evangelischen Kirche zeigt, warum das so ist, F.A.Z., 15.11.2023, 12.
Stolz, Jörg u.a. (2014): Religion und Spiritualität in der Ich-Gesellschaft. Vier Gestalten des (Un-)Glaubens, Zürich: TVZ.
Anmerkungen
- Bingener 2023.
- Diese Erstauswertung wurde unter Federführung des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD erarbeitet und auch gedruckt herausgegeben: EKD 2023.
- EKD 2023, 16. Die Seitenangaben im Text beziehen sich auf diese Broschüre.
- Vgl. EKD 2023, 18. Gemeint ist die Studie Stolz u.a. 2014. Der Mitautor Jörg Stolz ist auch Mitglied des Beirats der KMU.
- Die Schieflage wird durch eine Korrelation zweier Befunde bestätigt, die in der Auswertung für „schwer interpretierbar“ gehalten wird. Es verhält sich nämlich so, „dass 61 % derjenigen, die fehlenden Gottesdienstbesuch mit der Begründung rechtfertigen, dies sei ‚für ihre Spiritualität nicht wichtig‘, gleichzeitig deutlich ablehnen, ein ‚spirituell orientierter Mensch mit einer Verbindung zu einer höheren Wirklichkeit‘ zu sein“ (24). Ein unbestimmter Begriff von Spiritualität wird von ihnen gebraucht, die in Richtung esoterischer Religiosität enggeführte Aussage zur Spiritualität hingegen abgelehnt. – Es wäre außerdem zu berücksichtigen, dass sich gerade ein Teil der Hochreligiösen namentlich evangelikaler Prägung selbst niemals als „religiös“ oder „spirituell“ bezeichnen würden, weil beide Begriffe bei ihnen theologisch in Misskredit stehen. Sie würden sich stattdessen eher „gläubig“, „bibeltreu“, oder einfach „christlich“ nennen. In der KMU werden sie, weil das Feld der sprachlichen Optionen zur Selbsteinschätzung zu eng gefasst ist, unter den Belegen für den Religionsverlust verbucht.
- Bonhoeffer 1930, 94.
- Vgl. EKD 2023, 34: „Ich glaube, dass es ein höheres Wesen oder eine geistige Macht gibt“ (29 % Zustimmung). „Ich glaube nicht, dass es einen Gott, irgendein höheres Wesen oder eine geistige Macht gibt“ (33 % Zustimmung).
- In einem Artikel in der F.A.Z. am Tag nach der KMU-Vorstellung bei der EKD-Synode am 14. November hat Detlef Pollack, der als religionssoziologischer spiritus rector im Beirat der KMU eine maßgebliche Rolle spielte, sogleich weitreichende theologische Konsequenzen aus den Resultaten gezogen (Pollack 2023). Nach seinem Dafürhalten ist an den empirischen Ergebnissen der KMU der „Mythos“ der liberalen Religionstheologie Schleiermacher’scher Provenienz „zerbrochen“, es gebe so etwas wie ein „Christentum außerhalb der Kirche“ (Trutz Rendtorff). „Christentum als außerkirchliche Religiosität funktioniert nicht.“ (Mit dieser These hat er bei nicht wenigen Kirchenleitungsverantwortlichen emphatischen Applaus hervorgerufen, nachvollziehbarerweise: Wenn schon das Monopol auf die Religion überhaupt dahin ist, will man wenigstens das Monopol auf authentisches Christentum behaupten.) Pollacks Argument ist schlüssig – unter der Prämisse, dass sich christliche Religiosität wesentlich an den traditionellen kirchlichen Bekenntnisgehalten und Praktiken bemisst, die in der KMU dafür in Anschlag gebracht wurden. Man muss kein liberaler Theologe sein, um zu sehen, dass dieses Verfahren zirkulär ist: Man definiert die hard facts kirchlichen Christentums als Kern des Wesentlich-Christlichen und stellt daraufhin fest, dass es außerhalb der Kirche kein wahres Christentum gibt. Für diesen Schluss hätte man keine empirische Erhebung gebraucht; er ist selbstevident. Allein, seine Prämisse ist nicht empirisch zu beweisen. Sie hängt von der Auffassung vom Wesen des Christentums ab, die keine Sache der Empirie ist, das hätte man von Schleiermacher lernen können, sondern eine der normativen Idealbildung. Dialektik der Aufklärung: Pollack will den „Mythos“ der liberalen Theologie mit dem Logos quantitativer Sozialforschung austreiben. Er überzieht damit nicht nur das Konto der empirischen Methode, sondern verschleiert zugleich den Mythos derjenigen Theologie, die sie leitet.
- Barth 1934.
- An diesem Punkt wird gut greifbar, was in einer Art Sondervotum aus dem KMU-Beirat als Hauptargument für die methodische Schieflage der KMU-Auswertung vorgebracht wurde: Items für die Erhebung der Frömmigkeitspraxis von Kirchenmitgliedern werden umstandslos für die Frage nach der religiösen Gesamtlage verwertet – mit einigen Ergänzungen, die das gestiegene Gewicht der erzielten Befunde nicht tragen können (vgl. Anselm/Merle/Pohl-Patalong 2023).
- Fechtner 2023.
- Vgl. Fritz 2023.
- Vgl. EKD 2023, 17. Unter den Indices für „kirchenferne Religiosität“ finden sich hier die beiden Items „Es gibt Menschen, die durch Wahrsagen die Zukunft wirklich voraussehen können“ und „Die Stellung des Mondes und der Planeten kann uns anzeigen, wann im Leben es die richtige Zeit ist, etwas Bestimmtes zu tun“.
- Vgl. Stolz u.a. 2014, 67; zum Zeitraum der Datenerhebung a.a.O., 15.
- Ob diese communis opinio womöglich auch gewisse metaphysische und religiöse Probleme birgt, ist eine andere Frage.
- Über den Wert der anderen Teile ist damit nichts ausgesagt.
- Der Einwand, die Kirche sei infolge der fortgeschrittenen Entkirchlichung ohnehin nicht mehr länger „Volkskirche“, greift dabei nicht. „Volkskirchlichkeit“, etwa im Gegensatz zum Charakter der „Freikirche“, bezeichnet hier schlicht den Anspruch, eine integrative Kirche für verschiedenste Schattierungen und Intensitäten von christlicher Religiosität zu sein. Siehe dazu Fritz 2020b.
Ansprechpartner
 PD Dr. theol. Martin Fritz
PD Dr. theol. Martin FritzAuguststraße 80
10117 Berlin


